 |

Startseite
Über
uns
Orte
Personen
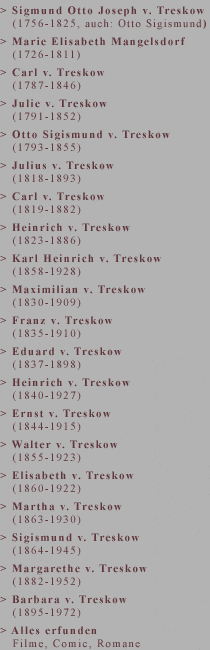
Kontakt
Mitglieder
Impressum
Datenschutz
|
 |
  |

Personen > Heinrich v. Treskow
(1840-1927), Generalleutnant
*
* Radojewo bei Posen 25. 10. 1840, + 27. 5. 1927 Radojewo; verh. 12. 7. 1871 mit Emma Bering Liisberg aus Aarhus/Dänemark.; V Heinrich v. Treskow (1795-1861), Gutsherr auf Radojewo; M Antonie, geb. v. Bünting (1811-1860); G Maximilian (1830-1909), Otto (1931-1901), Richard (1832-1914), Oskar (1833-1883), Franz (1835-1910), Eduard (1837-1898), Friedrich (1839-1857), Artur (1842-1913), Ernst (1844-1915), Hermann (1847-1870), Georg (1850-1851), Erich (1852-1922); S Waldemar (1872-1918), T Margarethe v. Treskow (1882-1952).
|
 |
| Heinrich v. Treskow mit drei seiner Brüder vor dem bereits umgebauten Gutshaus in Radojewo, um 1848 |
Heinrich war
einer der dreizehn Brüder aus Radojewo, von denen drei (Heinrich,
Franz, Eduard) preussische Generäle wurden. Trotz unterschiedlichster
Lebenswege trafen sich die Geschwister jedes Jahr an der sogenannten
13-Brüder-Kapelle im Park des Elternhauses Radojewo. Acht Brüder
nahmen als Offiziere am Krieg von 1866 und 1870/71 teil. Allein dieser
Umstand fand in der Presse des Kaiserreichs einigen Nachhall und wurde
oft thematisiert: „Die Chronikschreiber des Mittelalters berichten
von acht Brüdern v. Freysingen, welche unter Friedrich Barbarossa
in dem Lombardenkrieg mit großer Auszeichnung gefochten. So haben
auch acht Brüder v. Treskow unter den Preußen gefochten.
Zwei von ihnen wurden verwundet, die anderen kamen unversehrt davon.“ Für
Heinrich hatte der Deutsch-Dänische Krieg von 1864 noch ganz andere,
unvorhergesehene Folgen. Er lernte in Aarhus mir 24 Jahren den Kaufmann
und Brauereibesitzer Hans Laurits Bering Liisberg kennen und verliebte
sich in dessen Tochter Emma. Als Heinrich 1871 aus dem Krieg zurückkehrt,
fährt er als erstes nach Dänemark und heiratet Emma Bering
Liisberg am 12. Juli 1871 in Aarhus.
Stationen seiner militärischen Karriere war die Teilnahme an der Schlacht von Skalitz als Premier-Leutnant, bei der er den Zeigefinger der rechten Hand verlor und mit dem Roten Adler-Orden ausgezeichnet wurde. Im Krieg von 1870/71 machte er die Schlachten um Weißenburg, Wörth, Sedan und die Belagerung von Paris mit. Von September 1870 bis März 1871 war er Platzmajor in Versailles und erlebte aus nächster Nähe die Kaiserkrönung am 15. Januar 1871 mit. In der ersten und 1945 zerstörten Fassung des Monumentalbilds Anton v. Werners „Kaiserproklamation zu Versailles“ für den Weißen Saal des Berliner Schlosses war er unter Position 124 portraitiert.
 |
|
|
 |
| Anton v. Werner: Erklärungstafel zur Erstfassung des Bildes „Kaiserproklamation zu Versailles“ (zum Vergrößern auf das Bild klicken).
|
 Anton von Werner hatte hierzu 1871 eine eigene „Figurenstudie Premierleutnant von Treskow“ angefertigt, die heute im Berliner Kupferstichkabinett verwahrt wird (© SZ A. v. Werner 110 Objekt-ID: 3127501). Anton von Werner hatte hierzu 1871 eine eigene „Figurenstudie Premierleutnant von Treskow“ angefertigt, die heute im Berliner Kupferstichkabinett verwahrt wird (© SZ A. v. Werner 110 Objekt-ID: 3127501).
In den Folgejahren diente Heinrich im Berliner Kriegsministerium und als Major bei der Adjudantur des XIV. Armee-Corps in Karlsruhe, wo auch seine Tochter Margarethe geboren wurde. Es folgte die Beförderung zum Oberst 1879 und ab 1880 die Berufung in den Großen Generalstab. Nach Kommandeursposten in Stettin und Gotha wird er 1893 als Generalleutnant Stadtkomman-dant von Danzig. Drei Jahre später setzt sich in Gotha zur Ruhe. Nachdem die Tochter Margarethe 1907 ihren Cousin Hermann v. Treskow geheiratet hatte und Gutsfrau in Radojewo wurde zog die ganze Familie wieder auf das alte Familiengut bei Posen. Der einzige Sohn Waldemar fiel 1918 in Frankreich.
 |
| Die Brüder Erich, Arthur, Ernst, Heinrich, Richard (stehend, v.l.),
Otto und Franz v. Treskow (sitzend, v.l.) im Jahre 1900
|
Literatur:
Wöchentliche Anzeigen für das Fürstenthum Ratzeburg,
No. 85, 23. Oktober 1866, S. 2
Rangliste der Königlich Preußischen Armee, 1866 ff.
Reinhard Montag: Lexikon der Deutschen Generale (http://lexikon-deutschegenerale.de/)
Bartmann, Dominik (Hrsg.) (1993) Anton von Werner: Geschichte in Bildern. 978-3777461403. München: Hirmer Verlag, S. 340-341, 343.
|
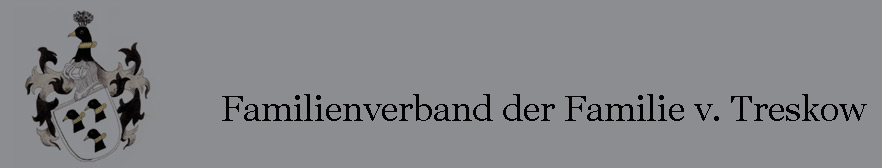
![]()
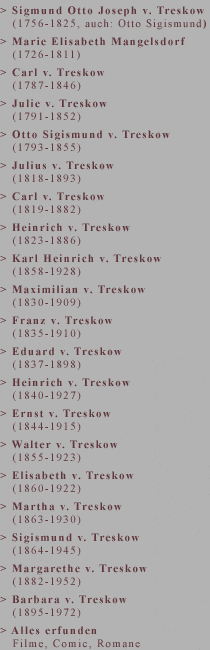



 Anton von Werner hatte hierzu 1871 eine eigene „Figurenstudie Premierleutnant von Treskow“ angefertigt, die heute im Berliner Kupferstichkabinett verwahrt wird (© SZ A. v. Werner 110 Objekt-ID: 3127501).
Anton von Werner hatte hierzu 1871 eine eigene „Figurenstudie Premierleutnant von Treskow“ angefertigt, die heute im Berliner Kupferstichkabinett verwahrt wird (© SZ A. v. Werner 110 Objekt-ID: 3127501). 